Laut einer Studie ist die jüngste Hitzewelle in Westeuropa wegen des menschengemachten Klimawandels um bis zu vier Grad heißer ausgefallen. Unterdessen meldete das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, dass der vergangene Monat der heißeste Juni war, der je in Westeuropa gemessen wurde.
Klima-Kipppunkte können die Welt unumkehrbar verändern.
Autor Toralf Staud im Gespräch über die Folgen und übertriebene Warnungen.
Die Welt erwärmt sich immer weiter und nähert sich dabei Kipppunkten im Klimasystem, die alles verändern können. Die Journalisten Toralf Staud und Benjamin von Brackel haben für ihr Buch „Am Kipppunkt“ mit zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen, um zu verstehen, wie diese Punkte funktionieren und wie nahe wir ihnen wirklich sind. Im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt Staud, welche Kippelemente man kennen sollte, was passiert, wenn wir sie erreichen – und warum alles auch noch in die richtige Richtung kippen könnte.
Was ist ein Kipppunkt im Klimasystem und warum muss man das überhaupt wissen?
Toralf Staud: Ein Kipppunkt ist der Moment, wo aus einer kleinen Änderung eine große Wirkung wird. Zum Beispiel sind zwei Grad Temperaturanstieg eigentlich nicht viel. Aber wenn ich ein Ei koche, dann führen zwei Grad mehr irgendwann dazu, dass das Ei gerinnt. Das ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen, das Ei ist hart, auch wenn ich es hinterher ins Eisfach lege. Und solche Mechanismen gibt es auch im Klimasystem, die nennt man Kippelemente.
Welche Kippelemente sollte man kennen?
Staud: Die Atlantische Umwälzzirkulation (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) zum Beispiel. Das ist ein riesiges Strömungssystem im Nordatlantik, zu dem auch der Golfstrom gehört. Das versorgt Europa mit Wärme und bestimmt unser Klima ganz entscheidend. Neuere Forschung weist jetzt darauf hin, dass die AMOC instabiler ist, als man lange dachte. Es gibt noch andere sehr bekannte Kippelemente, etwa den Amazonas-Regenwald oder das Eis auf Grönland. Aber die AMOC ist für Europa wohl das wichtigste.
Was passiert, wenn die Umwälzzirkulation kippt?
Staud: Die Folgen für Nordeuropa wären dramatisch. Es gäbe dann hier Winterstürme, wie sie der moderne Mensch noch nicht erlebt hat. Dafür kann man unsere Infrastrukturen und Städte praktisch nicht wappnen. Wir haben es im Buch mit Versicherungsmathematik beschrieben: Risiko ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Und die Schadenshöhe ist bei den Kipppunkten so hoch, dass das Stimmungsbild in der Forschung völlig klar ist: Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass wir diese Punkte erreichen. Gleichzeitig gilt: Wenn ein Kipppunkt erreicht ist, ist nicht automatisch Game Over.
Manche Kipppunkt sind schon erreicht oder sehr nahe, zum Beispiel beim schmelzenden Westantarktischen Eisschild. Was heißt das für Deutschland?
Staud: Nach allem, was wir wissen, sind wir in der Westantarktis wahrscheinlich schon an dem Punkt, an dem sich der Schmelzprozess selbst verstärkt und nicht mehr aufzuhalten ist. Aber wir können noch bestimmen, wie schnell der Eisschwund letztlich vor sich geht, wenn wir jetzt ernsthaften Klimaschutz betreiben.
Konkret für uns heißt das: Wir können noch bestimmen, wie schnell der Meeresspiegel steigt. Es macht für Küstenschutz oder das Umsiedeln von Städten einen großen Unterschied, ob das Wasser innerhalb von 100 Jahren um drei Meter steigt oder innerhalb von 500. Wenn man zum Beispiel in Hamburg lebt, hängt daran die Frage, ob die eigenen Enkel noch in der Stadt leben können, oder eben nicht. Unsere Städte bekommen jetzt ein Verfallsdatum. Aber wir können noch mitreden, wann das sein wird. Und bei manchen Elementen, zum Beispiel beim Amazonas-Regenwald, können wir noch vor dem Kipppunkt halt machen.
Kipppunkte können sich über Jahrhunderte bemerkbar machen – oder in wenigen Jahren
Wie schnell merken wir, ob ein Kipppunkt erreicht ist?
Staud: Das kann schnell gehen. Wir wissen aus der Erdgeschichte, dass der Übergang von einem Zustand in den anderen manchmal innerhalb von drei Jahren passierte. Beim Subpolarwirbel zum Beispiel, der ein Teil der Atlantischen Umwälzströmung ist, könnte es sehr schnell gehen. Auch das würde in Europa die Wettermuster drastisch verändern, und für die Landwirtschaft zum Beispiel ist es praktisch unmöglich, sich so schnell umzustellen. Bei anderen Kipppunkten entfalten sich die Wirkungen über Jahrhunderte.
Das klingt dramatisch. Wo liegt die Grenze zwischen angemessener Besorgtheit und Panikmache?
Staud: Diese Debatte gibt es auch in der Wissenschaft. Es gibt Forscherinnen und Forscher, die lieber gar nicht über Kipppunkte reden, weil es noch Ungewissheiten gibt. Die wollen lieber über den graduellen Klimawandel reden, weil die Schlussfolgerung eigentlich dieselbe ist: Die Emissionen müssen so schnell wie möglich runter. Die andere Fraktion sagt, die Risiken, die durch die Kipppunkte dazukommen, sind einfach so groß, dass sie es als ihre Aufgabe sehen, gerade darüber zu reden.
Manche aus der zweiten Gruppe warnen sehr drastisch auch vor Kaskaden …
Staud: Da geht es um die Idee, dass ein Kipppunkt den nächsten auslösen könnte und so weiter. Wir haben uns das angeschaut – das Risiko unendlicher Kaskaden halten wir für übertrieben. Theoretisch ist das möglich. Praktisch ist die Wirkung der einzelnen Kipppunkte auf die folgende Klimaentwicklung aber wohl immer noch kleiner als das, was wir durch unsere Emissionen direkt auslösen. Wir sind also weiterhin bestimmend, die Kipppunkte machen Klimaschutz nicht sinnlos.
Muss die Politik, wenn es ums Klima geht, mehr auf Kipppunkte schauen?
Staud: Ja! Wir hören jetzt immer wieder: Ob wir nur 2045 oder 2050 mit den Emissionen auf null sind, mache keinen Unterschied. An den Kipppunkten sieht man aber, dass es eben doch einen Unterschied macht. Das Risiko für Kipppunkte wird durch verzögerten Klimaschutz unverantwortlich hoch – und man kann das dann nicht mehr zurückholen, selbst wenn die Emissionen wieder sinken. Wie schon erwähnt: Wenn das Ei einmal gekocht ist, ist es zu spät. In Großbritannien wird längst daran geforscht, welche Früh-Indikatoren es zum Beispiel für den Zusammenbruch der AMOC gibt. Da hinkt die Debatte in Deutschland deutlich hinterher.
Positive Kipppunkte: Der Siegeszug von Photovoltaik und E-Autos
Im Buch geht es auch um positive gesellschaftliche Kipppunkte. Welche sind das?
Staud: Es gibt bei Klimaschutztechnologien einen Punkt, ab dem sie in ein Wachstum übergehen, das sich selbst weiter antreibt – den muss man erreichen. Ein wichtiger Faktor sind Kostensenkungen: Wenn man Technologien an der richtigen Stelle anschiebt, steigen die produzierten Mengen. Dadurch sinken die Kosten pro Stück. Niedrigere Kosten heißen mehr Nachfrage, das heißt mehr Produktion, das heißt weiter sinkende Kosten und so weiter. Der Prozess verstärkt sich selbst. Bei der Photovoltaik hat genau das geklappt, bei der Elektromobilität sind wir weltweit auch an einem solchen Kipppunkt. In China sind schon jetzt 50 Prozent der Neuzulassungen elektrisch, in Norwegen über 90 Prozent. So etwas anzustoßen, ist die einzig realistische Chance, noch unter den Temperaturgrenzen zu bleiben.
Wie löst man einen solchen Prozess aus?
Staud: Am wirksamsten: mit Quoten. Grüner Wasserstoff zum Beispiel hat ein Henne-Ei-Problem. Er ist teuer, deswegen nutzt ihn keiner, deswegen gibt es keine Nachfrage. Und ohne Nachfrage kann die Produktion nicht billiger werden. Es gibt aber einen Bereich, in dem man grünen Wasserstoff einsetzen kann, ohne dass es extra kostet.
Wo denn?
Staud: In der Düngerherstellung, Forscher haben das durchgerechnet. Bisher nimmt man Erdgas, um Ammoniak herzustellen und damit Kunstdünger zu produzieren. Erdgas ist seit dem Ukraine-Krieg aber viel teurer als vorher. Da kostet es wenig bis gar nicht mehr, stattdessen grünen Wasserstoff zu nehmen. Wenn jetzt die Regierungen in einigen Ländern sagen würden, 20 Prozent des bei uns verwendeten Kunstdüngers müssen mit grünem Wasserstoff produziert werden, dann hätte man die Nachfrage. Dann würden Elektrolyseure, die man für die Produktion braucht, schnell billiger, und damit auch der Wasserstoff. Und dann ist der preislich auf einmal konkurrenzfähig in anderen Einsatzbereichen wie Schiffstreibstoff. Es müssten gar nicht alle Länder weltweit mitziehen, ein paar Vorreiter reichen.
Wenn Sie einmal in die Glaskugel schauen – welche Kipppunkte erreichen wir eher, die negativen oder die positiven?
Staud: Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir einige negative Kipppunkte nicht mehr verhindern können. Wir werden ein instabileres, ungemütlicheres und Unsicherheit bringendes Klima bekommen. Aber noch haben wir die Möglichkeit zu beeinflussen, wie schlimm es wird.
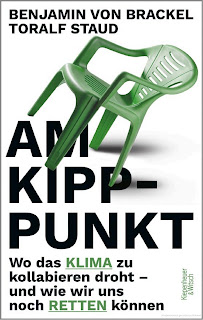

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen